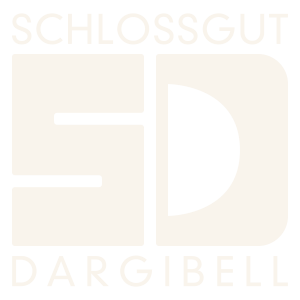Vor-Etappe
- Im 12. und 13. Jhd. war Vorpommern überwiegend durch slawische Volksgruppen (Wenden) besiedelt.
- 1128 kam Bischof Otto von Bamberg ins Peenetal, um den christlichen Glauben zu verbreiten. 1140 erfolgte die Gründung eines Bistums mit dem Bischofssitz in Wollin. 1153 wurden ein Benediktinerkloster in Stolpe an der Peene sowie das Kloster Grobe (Pudagla) auf der Insel Usedom gebaut.
- Mit der Gründung des Klosters Dargun 1178 begann die Geschichte des Adelsgeschlechts von Schwerin für Mecklenburg und Vorpommern.
- 1231 wurde Pommern Teil des Deutschen Reiches. Durch die beginnende Kolonisation durch Einwanderer (Adlige, Bauern, Arbeiter) aus dem westlichen Teil Deutschlands stieg die Einwohnerzahl stetig an. Die wendische Bevölkerung wurde nicht vertrieben, wenn sie den christlichen Glauben annahm. In den Dörfern wurden nun Kirchen errichtet.
- Um 1230 wurde ein Turmhügel, nicht weit entfernt vom heutigen Schloss Dargibell (später entstand darauf das „Saufhaus“), von den „Schwerinern“ besiedelt. Der Turmhügel hatte einen Durchmesser von 20 m und eine Höhe von 2 m, umgeben war er von einem 6 m breiten Graben. Auf dem Turmhügel wurde eine Turmhügelburg errichtet.
- Der Ort Dargibell wurde 1287 erstmals erwähnt. 1488 wurde er „Dargebel“ genannt. Die Adelsfamilie von Schwerin bezog Bede (Steuern) von Dargibell (nach Aussage eines Mitgliedes der Familie 1494). 1533 wurde Dargibell allerdings nicht mehr erwähnt. Der Ortsname Dargibell bedeutete „Liebes Haus“, „Liebes Kind“ oder „Sitz des Dargibyl“und ist wendischen Ursprungs.
- Im 15. Jhd. bewohnten die von Köppern das Gut Dargibell. Sie erhielten das Lehen über Dargibell, Rossin und Kagendorf vom Kloster Stolpe.
- Ende des 15. Jhd. wurde im Gut Dargibell eine Dorfkirche (Kapelle), ein flach gedeckter rechteckiger Saalbau, aus Feldsteinmauerwerk errichtet.
- Bis 1651 war das Gut Dargibell im Besitz der Familie von Wolde. In einer Urkunde (Lehnbrief) von 1338 wurde es als Lehen des Adelsgeschlechts von Wolde erwähnt. Am 23.4.1551 erhielt Baltasar von Wolde „Doctor beider Rechte“ einen Lehnbrief über die Güter Dargebel, Müggenburg, Kagendorf und Rossin.
1. Etappe | 1651 bis 1761 (110 Jahre)
Die Zeit der Familie von Eickstedt
1. Bauphase
- 1651 verkaufte die Witwe des Hauses von Wolde das Gut Dargibell (mit einem bescheidenen Gutshaus) an Franz Dubslaff (Dubslaw) von Eickstedt (1628-1706) für 18.000 Gulden.
- Das „alte Gutshaus“ (mit hohem Mansarddach über ziegelsichtigen Wänden mit eingesprengten Feldsteinen) wurde wahrscheinlich Ende des 17. Jhd. gebaut. Im Erdgeschoss fanden sich 4 Kamine. Wahrscheinlich war es der Vorgängerbau des späteren barocken Herrenhauses.
- Auf einer Schwedenmatrikel (Flurkarte) von 1693 (oder 1691 ?) findet sich die früheste kartographische Darstellung von Dargibell (hier Dargeberg genannt) und dem Turmhügel mit dem Wassergraben. Das abgebildete Haus Nr. 1 ist das Haus des Hauptmannes von Eickstedt.
- Der letzte Besitzer Leonhard von Eickstedt beauftragte 1751 den Bau eines neuen Gebäudes, Teile davon müsste man heute noch finden. Ob es sich dabei um das Wirtschaftsgebäude mit Mansarddach (aus Feldsteinen erbaut), einem Gebäude, auf dessen Fundament später das Schloss (2. Bauphase) errichtet wurde, oder um das heute alleinstehende „alte Gutshaus“(welches später als Kornspeicher genutzt wurde) handelte, ist ungeklärt. Die Vielzahl von Kellergewölben und Gängen (wie z.B. der berühmte Geheimgang zum Turmhügel), die zum Großteil zugeschüttet wurden, lassen viel Spielraum für Fantasie und Spekulationen.
2. Etappe | 1761 bis 1773 (12 Jahre)
Die Zeit des Generalmajor Otto Martin von Schwerin
2. Bauphase
- Am 30.7.1761 kaufte Otto Martin (Magnus) von Schwerin (1701-1777) nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst für 15.500 Thaler das Gut Dargibell.
- 1763 (oder 1765?) ließ er das „Saufhaus“, einen kleinen Jagdpavillon (mit fast quadratischem Grundriss 6,40 x 6,60 m) mit Weinkeller und Zugbrücke über den vorm Haus befindlichen Graben, auf dem frühdeutschen Turmhügel errichten. Der Wein und Geselligkeit liebende Graf veranstaltete dort regelmäßig Trinkgelage. Er war tapfer, bescheiden, philosophisch interessiert, hoch gebildet, sprach mehrere Sprachen, bereiste Europa und war bei der Bevölkerung sehr beliebt. Er gehörte der evangelisch-reformierten Kirche an.
- Um 1770 erfolgte der Bau des Mittelteiles des heutigen Schlosses mit einem von zwei dorischen Säulen eingerahmten Haupteingang und Fledermausgauben an den Stirnseiten. Das Gebäude wirkte bescheiden mit einem gediegenen Barock-Charakter. Ob dieses Gebäude barock umgebaut oder sogar neu errichtet wurde, ist nicht geklärt. Im Erdgeschoss gab es 6 Räume, im Untergeschoss einen 3-teiligen Weinkeller (Gewölbekeller) mit eigenem Ausgang zur Straße hin. Weitere Kellerräume wurden zugeschüttet, somit sind deren Entstehungsjahre ungeklärt. Im Obergeschoss waren die 6 Zimmer ebenfalls spiegelbildlich zur mittig verlaufenden Symmetrieachse angeordnet. Das „alte Gutshaus“ wurde nun als Kavaliershaus für die Gäste genutzt und diente auch als Inspektorenhaus. Später wurde ein Speicheraufzug im Giebel installiert und es zu einem Kornspeicher umfunktioniert. Die Dorfkirche ließ er barock verändern.
- kurzer biografischer Abriss (Otto Martin von Schwerin):
- geb. 21. Juni 1701
- mit 13 Jahren Eintritt in den preußischen Militärdienst (später dort als der Hohenfriedberger oder der Reitgerten-Schwerin bekannt)
- seine Einheit, das Dragoner-Regiment-Bayreuth-Nr. 5, befand sich in Pasewalk
- 1718 Leutnant
- 1730 Rittmeister
- 17.12.1732 Heirat mit Freiin Esther Maria von Quadt zu Landskron, es wurden 11 Kinder geboren, die überwiegend im Kleinkindalter verstarben, 3 Kinder überlebten ihn (mindestens 9 Enkelkinder)
- 1733 Major
- 1737 Ritter des Johanniter-Ordens
- ab 1741 Regimentskommandeur
- ab 1742 Oberst
- Teilnahme an mehreren Kriegseinsätzen
- 1745 im 2. Schlesischen Krieg wurde er als Held von Hohen-Friedberg geehrt
- ab 1745 Generalmajor
- 1744 und 1746 Kritik durch König Friedrich II (Friedrich der Große/ „Alte Fritz“): er solle das Saufen mit ihm unterstellten Offizieren abschaffen
- 1755 (bereits Generalleutnant) erneut Rüge wegen Alkoholproblemen in seiner Einheit, daraufhin bat er um das Ausscheiden vom Militärdienst und betonte, dass er „den Degen nicht mehr ziehen würde“, der König lehnte ab
- 1756 letzte Schlacht (mit Reitpeitsche, ohne Degen)
- 1757 der König genehmigte das Ausscheiden vom Militärdienst, Rückzug auf sein Gut in Busow (welches ihm urkundlich seit 1746 gehörte, seine Vorfahren waren ebenfalls Grundherren von Busow)
- 30.7.1761 Kauf des Schlossgutes Dargibell und Errichtung des Schlosses um 1770
- gest. 14. August 1777 in Busow, Bestattung in Dargibell (allerdings fand man nach Öffnung der Gruft 1915 darin nur den Sarg eines Fräuleins von Eickstedt, vermutlich wurde er heimlich vom „Alten Fritz“ in Potsdam bestattet)
- Die Dargibeller Linie des Geschlechts von Schwerin wurde von Otto Jacob von Schwerin (1636-1720) gestiftet, dem Großvater von Otto Martin. Dieser lebte vermutlich seit 1664 in Busow, seine Lehen empfing er 1705. Da sein Vater ihn überlebte, gelangte Johann Georg (1668-1712) (verheiratet mit Maria Esther von Dockum), der Vater von Otto Martin, nicht in den Besitz von Busow. 1720 erbten die beiden Brüder Friedrich Leopold (1699-1750) und Otto Martin von ihrem Großvater gemeinsam diesen Besitz. Durch Ankauf weiterer Anteile gelangte schließlich Otto Martin 1750 in den alleinigen Besitz von ganz Busow. Sein Bruder starb unverheiratet 1750 in Berlin.
3. Etappe | 1773 bis 1851 (78 Jahre)
Die Zeit der Kinder und Enkel des Otto Martin von Schwerin
- 1773 erbte der Sohn Ludwig Wilhelm Albrecht (1743-1777) das Schlossgut Dargibell, nach dessen Tod 1777 sein Bruder Moritz Friedrich Wilhelm (1745-1829), der bereits Eigentümer des Gutes von Busow war und dieses am 20.1.1786 für 39.400 Thaler an den Grafen Heinrich Bogislav Dettlof von Schwerin auf Schwerinsburg verkaufte. 1777 verlegte er somit seinen Wohnsitz nach Dargibell.
- Moritz Friedrich Wilhelm heiratete 1774 Helene Elenore Marianne Freiin von Stosch (1759-1826). In der Ehe wurden 5 Kinder geboren.
- 1779 fand sich die Bezeichnung „Dargibel“.
- Moritz Friedrich Wilhelm war Landschafts-Deputierter in Vorpommern und seit 1793 „Landrath des Anclamer Kreises“. 1821 überließ er das Schlossgut Dargibell seinem Sohn Ludwig Moritz August (1785-1857), der ab 1825 Landwirtschaft auf Dargibell betrieb. Er war in erster Ehe mit seiner Cousine Friedrike Charlotte Bernhardine Henriette von Linstow, Tochter seiner Tante Friedrike CarolineWilhelmine von Schwerin (1751-1810) verheiratet. Der gemeinsame Sohn Carl Heinrich Friedrich Wilhelm Bernhard (1809-1859) war der letzte in Dargibell geborene aus der Dargibeller Linie. Seine vier Kinder wurden in Rebelow geboren. Mit seiner zweiten Ehefrau, der Jenny von Köppern, die er 1853 ehelichte, schloss sich gewissermaßen der historische Zirkel zu den ersten Bewohnern/ Besitzern des Schlossgutes Dargibell.
- Am 24.6.1851 verkaufte Ludwig Moritz August das Schlossgut Dargibell an den Hauptmann a.D. Adolph Louis Wilhelm von Happe und zog nach Anklam, wo er 1857 verstarb.
4. Etappe | 1851 bis 1860 (9 Jahre)
Die Zeit des Hauptmanns von Happe
- Das Schlossgut Dargibell gehörte dem Hauptmann Adolph Louis Wilhelm von Happe.
- In den statistischen Aufzeichnungen des Dr. Heinrich Berghaus von 1865 steht, dass er bereits am 19.7.1850 für 80.000 Thaler das Schlossgut gekauft haben soll, später für 1875 Thaler die Windmühle des Ortes dazu und 10 Jahre später das gesamte Anwesen mit Inventar für 115.000 Thaler am 2.4.1860 an Graf Bernhard von Schwerin verkaufte.
5. Etappe | 1860 bis 1894 (34 Jahre)
Die Zeit des Rückkaufes des Schlossgutes Dargibell durch die Schwerinsburg-Busower Linie
- Graf Bernhard Wilhelm Ludwig Helmut Carl von Schwerin-Busow (1831-1906) kaufte 1860 das Schlossgut Dargibell zurück. Im gleichen Jahr kaufte er auch das Gut Busow und 1895 das Gut Stolpe auf Usedom. Das Gut Ducherow übernahm er 1868 durch brüderlichen Vergleich aus der Erbschaft seines Vaters Graf Carl Christoph Adolf George von Schwerin (1780-1853). Er war das jüngste von 11 Kindern. Seine Mutter Elisabeth Rosamunde Barbara Friedrike Freiin von Maltzan (1797-1874) war die zweite Ehefrau seines Vaters.
- Er vermählte sich am 23.1.1861 mit Valerie (Wally) Amalie von Katte (1842-1931). Ihre 3 Kinder wurden in Dargibell geboren. Für den Zeitraum ab 1870 ist ungeklärt, wer noch im Schlossgut Dargibell wohnte. Anscheinend ist die junge Familie nach Ducherow gezogen, wo er 1873 ein Herrenhaus errichten ließ.
- 1861/62 gehörten zu Dargibell: 1 Kapelle, 1 Schulhaus, 1 Herrenhaus, 6 Wohnhäuser, 13 Wirtschaftsgebäude und in den 22 Haushaltungen lebten 123 Menschen. An Vieh wurden 30 Pferde, 56 Rinder, 1200 halbveredelte Schafe und 62 Schweine gehalten.
- Durch den Ausbruch der Cholera starben 1866 25 Menschen in Dargibell.
- 1884 wurde die Schmalspurbahn (über Dargibell) gebaut.
- Die Garten- und Parkanlage des Schlossgutes Dargibell wurde 1884 von Hans von der Dollen in seinem Heft „Streifzüge durch Pommern“ folgendermaßen beschrieben: alter, französisch gehaltener Garten (barocker Garten) mit geraden Gängen, beschnittenen Buchenhecken und Taxusfiguren, 2 Linden vorm Herrenhaus, lange Pappelallee nach Kagendorf.
- Bernhard W. L. H. C. vererbte 1894 das Schlossgut Dargibell seinem ältesten Sohn Ulrich Friedrich Carl (1865-1946). Seinem jüngsten Sohn Friedrich Rudolf Bernhard (1869-1924) schenkte er 1895 das Gut Stolpe zur Hochzeit mit Freda Anna Wilhelmine von Kleist (1872-1957).
6. Etappe | 1894 bis 1907 (13 Jahre)
Die Zeit der Familie des Grafen Ulrich Friedrich Carl von Schwerin
3. Bauphase
- Das Schlossgut Dargibell wurde 1894 an den Sohn Graf Ulrich Friedrich Carl von Schwerin (1865-1946) vererbt, der mit seiner Ehefrau Gräfin Klara von Kanitz (1870-1932) und den vier Kindern [ Walti Luise Agnes (1897-1996), Manfred (1895-1999), Otto Martin (1894-1997) und Bernhard (1892-1918) ] bis zum Tode des Vaters 1906 dort lebte und anschließend 1907 nach Ducherow umzog. In Dargibell gab es zu dieser Zeit keine selbstständigen Bauern, alle Einwohner arbeiteten auf dem Gut.
- Die sogenannte 3. Bauphase begann zu Beginn der 90er Jahre und dauerte bis 1902. Sie wurde vom Architekten Winter aus Stralsund betreut. Das Schloss sollte dem Bautypus der maison de plaisance (Lustschloss) ähneln, einem verspielten kleinen Rückzugsort für das private freizeitliche Vergnügen. In Dargibell allerdings bildete das Schloss den Mittelpunkt eines landwirtschaftlichen Betriebes. Es ist ein eingeschossiger Putzbau über einem sehr flachen Sockel aus Feldsteinen mit hohem Mansarddach, dessen stehende Gauben übergiebelt sind.
- An der Südostseite erfolgte ein flügelartiger Anbau (Südostflügel) mit einem flachen zweigeschossigen Mittelrisalit und dem Allianzwappenrelief der Familien Kanitz und Schwerin im Frontispiz. Ein zweiflügeliges Rundbogenportal bildete den Nebeneingang mit als „Freitreppe“ vorgelagerter kleiner Terrasse. Die Gebäudeöffnungen sind nur hier rundbogig geschlossen. Im Anbau wurden ein Badezimmer und ein WC eingerichtet, diese gab es bis dahin im Haupthaus noch nicht. Im Keller (Preußenkeller) gab es zwei größere Räume, hinter denen weitere Kellerräume zu vermuten sind, die allerdings zugeschüttet wurden.
- Die Straßenseite des Haupthauses erhielt einen dreiachsigen zweigeschossigen Mittelrisalit mit einem Rundbogenportal, dem ein von zwei Säulen getragener gesprengter (gebrochener) Giebel vorgesetzt wurde. Im Frontispiz wurde ein Ochsenauge eingesetzt. Den Haupteingang erreichte man über eine Auffahrt.
- Auch die Parkseite des Haupthauses erhielt einen dreiachsigen, flachen, schlichten Mittelrisalit mit einem Ochsenauge im Frontispiz. Im oberen Dachbereich erschien eine Fledermausgaube. In der Ecke zwischen Haupthaus und Südostflügel entstand ein kleiner Wintergarten.
- Alle stehenden übergiebelten Gauben wurden aufwendig mit hölzernem Zierwerk verschönert. Alle gerade geschlossenen Fenster und Türen sind mit geohrten Putzfaschen und Keilsteinen versehen, zum großen Teil mit Mittelkreuzstockfenstern.
- Der barocke Garten verschwand und es entwickelte sich ein Landschaftspark, malerisch und natürlich, orientiert am englischen Landhausstil.
- Die Eingangshalle wurde im englischen Landhausstil umgebaut, Wandschränke eingebaut und die Decke zum Obergeschoss durchbrochen. Somit entstand eine Treppe mit Galerie.
- Aus dem Gartensaal mit vorgelagerter hölzernen Loggia, über der sich ein Balkon befand, wurde ein Spiegelsaal in Anlehnung an das friderizianische Rokoko mit Stuckreliefs an Decke und Wänden sowie einer Spiegelpyramidenkuppel in der Mitte der Decke mit einem venizianischen Kronleuchter.
- Der Speisesaal (Esszimmer) und das Herrenzimmer wurden im englischen Landhausstil neu vertäfelt. Der Speisesaal wurde durch das Entfernen einer Zwischenwand vergrößert.
- Durch Teilung des ehemaligen Salons entstanden das Gräfinnenzimmer und ein kleinerer Nebenraum mit kleinem Wintergarten.
- Das Wirtschaftsgebäude („altes Haus“) wurde mit dem Haupthaus verbunden (Verbindungsstube).
7. Etappe | 1907 bis 1945 (38 Jahre)
Die Zeit der letzten Grafen im Schlossgut Dargibell
- Das Schlossgut Dargibell wurde vermietet, verpachtet oder stand leer. Freunde und Verwandte der von Schwerins verbrachten dort ihre Sommerferien.
- Der Graf Ulrich Friedrich Carl von Schwerin lebte bis 1945 in dem geerbten Gut Ducherow. Er verstarb 1946 in Marburg. Das Schlossgut Dargibell gehörte bis zur Enteignung 1945 zu seinem Besitz. Sein Sohn Otto Martin war der letzte Graf von Schwerin in Dargibell (er starb 1997 in Kanada). Otto Martin heiratete 1924 auf dem Gut Stolpe, das seine Tante Freda bewohnte, die in Russland geborene Baronesse Alexandra Gerschau von Flotho (1896-1942), die er auf demselben Gut auch kennengelernt hatte. Alexandra floh mit ihrer Mutter und den zwei Schwestern nach der Oktoberrevolution 1917 vor den Bolschewiken nach Deutschland und fand Unterkunft bei den von Schwerins in Stolpe. In Russland lebten sie im Schloss Peterhof, der Sommerresidenz der russischen Zaren und waren mit der Zarenfamilie befreundet. Das Paar hatte zwei Kinder, Bernhard (1927-2022) und Gamma (1930 geboren), und lebte in Ducherow, später wanderten die Kinder Richtung USA/ Kanada aus.
- Der jüngste Sohn Manfred war mit Hertha von Nostitz (1894-1965) verheiratet.
- Die Tochter Walti heiratete am 30.5.1923 Friedrich Wilhelm Kritzinger (1890-1947). Das Paar hatte 3 Kinder: Giesela (1926-1985), Friedrich Wilhelm Ulrich (1928 geboren) und Manfred (1933 geboren).
- Von 1913 bis ca. 1916 wurde das Schlossgut Dargibell an die Familie von Stein, Hans von Stein und Ehefrau Doris, geb. von Auerswald, vermietet. Der Inspektor Schmeling bewohnte zu dieser Zeit mit seiner Familie einen Teil des Hauses. 1928 wurde er immer noch als Pächter erwähnt.
- 1917 beherbergte das Schlossgut Dargibell erholungsbedürftige Kinder aus dem Ruhrgebiet.
- 1934 tagte im Schlossgut Dargibell die Kreisschule der NSDAP.
8. Etappe | 1945 bis 1989 (44 Jahre)
Die Zeit des DDR-Volkseigentums
- Die Familie von Schwerin wurde 1945 enteignet.
- 1945 wurde die Gleisanlage abgebaut.
- Nach dem 2. Weltkrieg wurden Vertriebene und Flüchtlinge im Schlossgut Dargibell untergebracht.
- Der Marstall wurde 1948 abgerissen und 1952 ein älteres, leider nicht näher beschriebenes, Gebäude auf dem Anwesen.
- Ab 1958 wurden die Gebäude von der örtlichen LPG und der Gemeinde als Speise- und Wohnraum, Kindergarten und Konsumverkaufsstelle genutzt, das „alte Gutshaus“ als Stall oder zum Trocknen des angebauten Tabaks. Auch Familienfeiern fanden im Schlossgut Dargibell statt.
- 1960 wurde die 1942 eingestürzte Dargibeller Dorfkirche wieder aufgebaut, dabei ging der Kirchturm verloren. Am Ostgiebel befindet sich eine Glockennische.
- Die Unterhaltung des Anwesens wurde in diesem Zeitraum grob vernachlässigt.
9. Etappe | 1989 bis 2020 (31 Jahre)
Die Nachwendezeit
- Aufgrund mehrerer Eigentümerwechsel und den dementsprechenden wenigen Bauunterhaltungsmaßnahmen verfiel das Anwesen weiter.
- Es wurden Fliesen, Wandverkleidungen und das gesamte Inventar entwendet oder zum Ausbau freigegeben.
- Die letzten Mieter zogen bis ca. 2000 aus dem Südflügel aus.
10. Etappe | ab 2020
Die Zeit des Wiederaufbaus und der Zukunftsvisionen
4. Bauphase
- 2020 Kauf des Anwesens durch Peter Foydl
- zum Schlossgut Dargibell gehörten zu diesem Zeitpunkt das Schloss mit dem Südostflügel, Teile der Verbindungsstube, das Alte Gutshaus, Reste der Außenmauer sowie der stark zugewucherte Park und die Storchenwiese gegenüber des Haupthauses
Anhang
Bezeichnungen / Synonyme
Schlossgut / Gutsanlage / Anwesen
Schloss 1770 / Herrenhaus / Haupthaus
„Saufhaus“ 1763 / kleiner Jagdpavillon / nur noch Gewölbereste vorhanden
Altes Gutshaus 15. Jhd. mit Gutsküche (Schwarzküche) / später Kavaliershaus und Kornspeicher
Schlosskapelle Ende 15. Jhd. / Dorfkirche / Dorfkapelle
Wirtschaftsgebäude / Wirtschaftshaus / „Altes Haus“
Nutzung ab Ende des 19. Jhd.: 2 Küchen, 1 Waschküche, Keller, Vorratskammer, Mädchenzimmer, Taubenschlag im Dach / zu DDR-Zeiten abgerissen
Südostflügel 1894 / Anbau ans Haupthaus / Neubau / Südflügel / Süd-Ost-Seite / Kopfbau
Verbindungsstube / Verbindung Haupthaus-Wirtschaftsgebäude
Nutzung ab Ende des 19. Jhd.: Näh- und Plättstube
Parkanlage / Schlossgarten
Parkseite / Gartenseite
Straßenseite / Hofseite
2 x Keller im Schlossgebäude / Gewölbekeller im Haupthaus und Preußenkeller im Südostflügel
grünes Zimmer / Grafenzimmer / Arbeitszimmer
Speisesaal / Esszimmer
Foyer / Eingangshalle / Umlauf / Galerie / Treppenhaus im Haupthaus
Gräfinnenzimmer / Salon
Spiegelsaal / Saal / Gartensaal
Storchenwiese / ehem. Wirtschaftshof mit Schafstall u.a. Nebengebäuden
Quellen
- Lothar Kohls: Das Adelsgeschlecht von Schwerin zwischen Peene und Landgraben
- Walti Kritzinger: Meine Erinnerungen an Dargibell
- Manfred Kritzinger : Dargibell, der Ort
- Doris von Auerswald & Alexandra von Stein: Eine Kindheit und Jugend in Preussen um 1900
- Wikipedia April 2022: Gutshaus Dargibell
- Katharina von Pentz: Das Herrenhaus Dargibell
- Versteigerungsunterlagen
- Heinrich Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommerns und des Fürstenthums Rügen, Teil 2, Band 1, 1865 (statistische Zahlen von 1861)
- L. Gollmert: Biografische Nachrichten über das Geschlecht von Schwerin, 1878
- Bernhard von Schwerin: My life
- mündliche Überlieferungen
- eigene Feldforschung
Recherche: März 2023 | Pola Fleischer